Deutsche Wirtschaftspolitik in der Corona-Krise: Wie Deutschland seine Wirtschaft zu schützen versucht
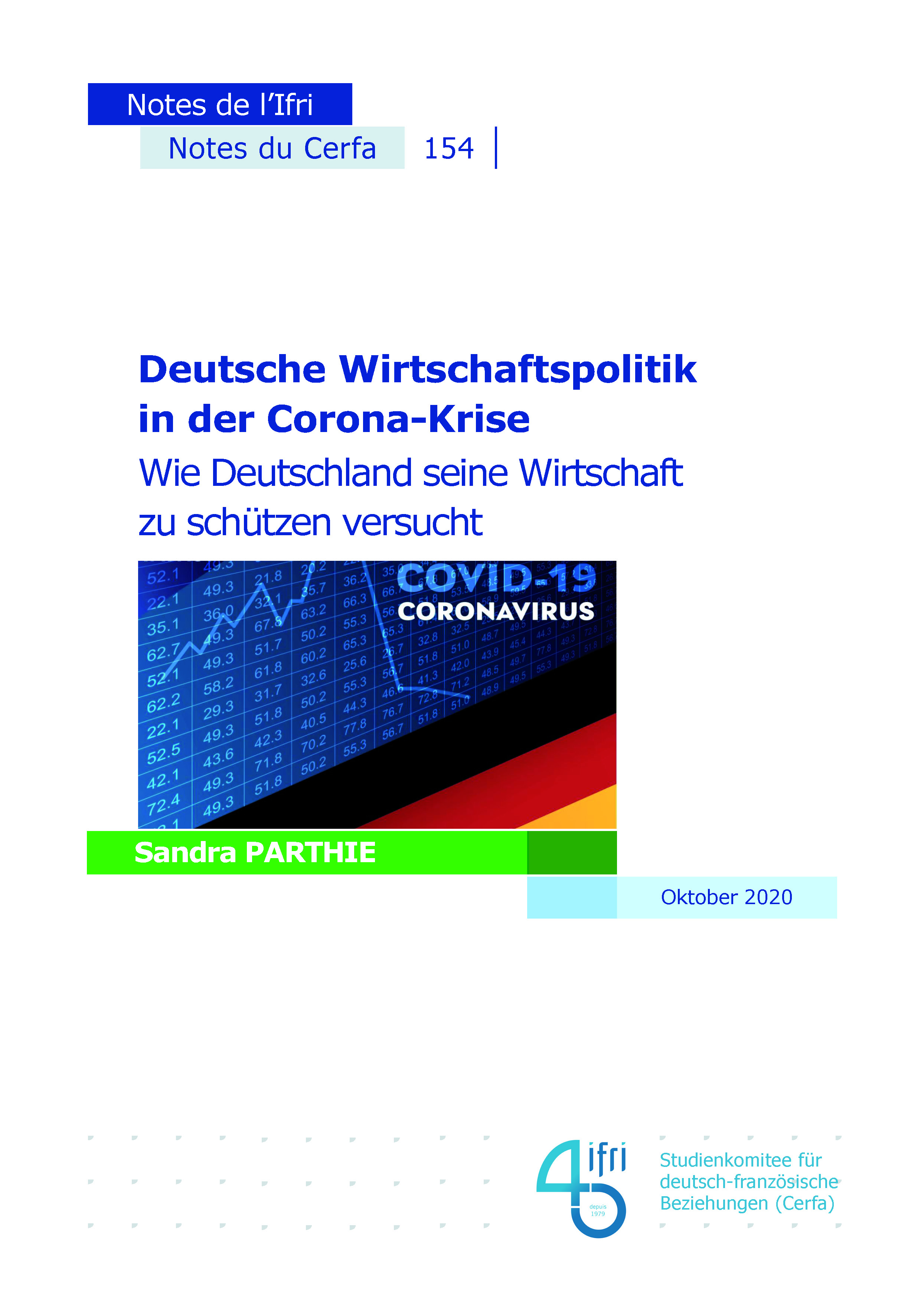
Verglichen mit anderen europäischen Staaten hat sich der deutsche Umgang mit der COVID-19 Krise als effizient erwiesen. Das deutsche Gesundheitssystem hat den Kampf gegen die Pandemie gut gemeistert, die Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt wurden durch die Kurzarbeit abgefedert, Unternehmen wurden massiv und zeitnah unterstützt, die Regierung hat sich reaktiv gezeigt.

Das Jahr 2020 wird global vom Corona-Virus dominiert. Die Pandemie wirkt in alle gesellschaftlichen Bereiche hinein, zwingt zur Änderung von Gewohnheiten, bedroht die wirtschaftliche Basis und Entwicklung von großen und kleinen Unternehmen und legt Mängel in der Politik offen. Die vorliegende Analyse beleuchtet Betroffenheit und Reaktion Deutschlands, startend mit den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen bei Ausbruch der Pandemie. Außerdem wird das Gesundheitssystem der Bundesrepublik unter dem Aspekt betrachtet, wie es mit den Corona-bedingten Herausforderungen umgegangen ist. Der dritte Teil widmet sich einerseits den politischen Akteuren und andererseits der Rolle bestehender Strukturen bei der Bekämpfung insbesondere der wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie. Abschließend wird der Blick auf grenzüberschreitende Fragen mit Relevanz für den EU-Binnenmarkt gelenkt, bevor dann Empfehlungen für die nationale und die europäische Ebene abgeleitet werden.
Sandra Parthie leitet seit 2015 das Brüsseler Büro des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW).
Diese Publikation ist auch auf Französisch verfügbar: "La politique économique allemande face à la crise du COVID-19. Comment l’Allemagne soutient son économie" (pdf)

Inhalte verfügbar in :
ISBN/ISSN
Verwendung
So zitieren Sie diese VeröffentlichungTeilen
Laden Sie die vollständige Analyse herunter
Auf dieser Seite finden Sie eine Zusammenfassung unserer Arbeit. Wenn Sie mehr Informationen über unserer Arbeit zum Thema haben möchten, können Sie die Vollversion im PDF-Format herunterladen.
Deutsche Wirtschaftspolitik in der Corona-Krise: Wie Deutschland seine Wirtschaft zu schützen versucht
Verwandte Zentren und Programme
Weitere Forschungszentren und ProgrammeMehr erfahren
Unsere VeröffentlichungenDie Deutsch-Französische Brigade und der Wiederaufbau der europäischen Verteidigung
Seit Donald Trumps Rückkehr ist klar: Das europäische Einigungsprojekt ist existenziell gefährdet. Gelingt es den Europäern angesichts des anhaltenden Krieges in der Ukraine und schwindenden US-Sicherheitsgarantien nicht, verteidigungspolitisch souverän zu werden, werden die Integrationsbereitschaft im Inneren und die Attraktivität der EU nach außen weiter erodieren.
Friedrich Merz und die „Zeitenwende 2.0“: eine „neue Ära“ für die transatlantischen Beziehungen?
Am 23. Februar 2025 waren fast 60 Millionen Wähler aufgerufen, einen neuen Bundestag zu wählen. Diese Wahlen werden auch eine neue Regierung in der größten Volkswirtschaft Europas hervorbringen.
Nach den Wahlen: Deutschland auf der Suche nach erschütterter Stabilität?
Mit einer Wahlbeteiligung von 82,5 % hat Deutschland die höchste Beteiligung seit 1987 verzeichnet – ein Anstieg um 6,1 Prozentpunkte im Vergleich zu 2021. Wie schon damals hat die hohe Wahlbeteiligung vor allem der Alternative für Deutschland (AfD) genutzt, die viele frühere Nichtwähler mobilisieren konnte. Viele Wähler wollten mit ihrer Stimme die scheidende Regierung abstrafen, deren Zustimmung vor dem Bruch der Koalition im November 2024 nur noch bei 14 % lag. Deutschland steuert nun aller Wahrscheinlichkeit nach auf eine Große Koalition aus CDU/CSU und SPD zu – die Sondierungsgespräche haben am 28. Februar begonnen.
Wartet Frankreich auf Friedrich Merz?
In den vergangenen Wochen hat sich Friedrich Merz wiederholt für eine engere deutsch-französische Zusammenarbeit ausgesprochen. Wie viel Veränderung könnten seine Appelle tatsächlich bewirken?







