Die Zukunft der Günen: auf dem Weg zur Scharnierpartei?
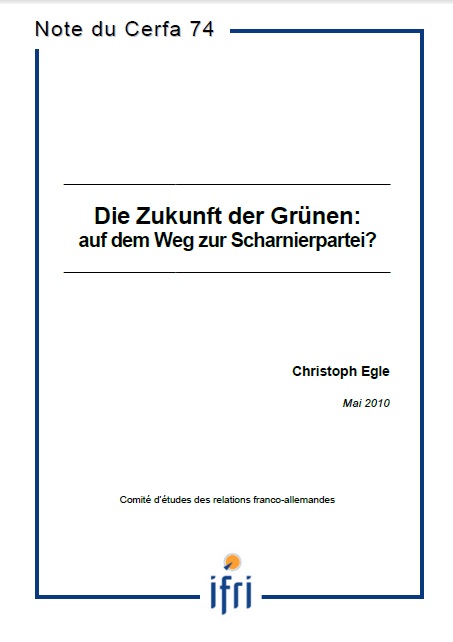
Im Laufe der letzen 30 Jahre konnten sich die Grünen fest im Parteiensystem verankern und durch ihre Beteiligung an verschiedenen Landesregierungen und der Bundesregierung maßgeblichen Einfluss auf die Politikgestaltung nehmen.Die außerparlamentarische Protestbewegung hat sich über eine parlamentarische Oppositionspartei hin zu einer professionellen Regierungspartei entwickelt. Die Veränderungen der Grünen-Wähler und der Parteimitglieder reflektieren ihre soziale Etablierung: Überdurchschnittlich erfolgreich sind die Grünen bei Personen mit hohem formalem Bildungsgrad, bei Beamten, Angestellten und Selbständigen, in jüngeren Altersgruppen, bei Frauen und bei Konfessionslosen. Ihre lokalen Hochburgen haben sie in Großstädten und in stark urbanisierten Regionen mit einem hohen Gewicht des Dienstleistungssektors.Parallel dazu kann die Programmentwicklung durch die Begriffe „Deradikalisierung“ und „Normalisierung“ beschrieben werden. Da sich andere Parteien zunehmend den ökologischen Themen annehmen, reagieren die Grünen darauf mit einer „Radikalisierung“ ihrer Positionen im Bereich der Umweltpolitik. Ihre Positionierung im Zentrum der Gesellschaft bietet ihnen Koalitionsmöglichkeiten mit der CDU/CSU, der SPD und/ oder der FDP. Sollte dies gelingen, werden die Grünen vermeiden könne sich zu einer Nischenpartei zu entwickeln und zur ScharnierparteiDeutschlands werden.
Christoph Egle ist seit 2007 wissenschaftlicher Mitarbeiter am Geschwister-Scholl-Institut für Politikwissenschaft der Ludwig-Maximilians-Universität München.

Inhalte verfügbar in :
Regionen und Themen
Verwendung
So zitieren Sie diese VeröffentlichungTeilen
Laden Sie die vollständige Analyse herunter
Auf dieser Seite finden Sie eine Zusammenfassung unserer Arbeit. Wenn Sie mehr Informationen über unserer Arbeit zum Thema haben möchten, können Sie die Vollversion im PDF-Format herunterladen.
Die Zukunft der Günen: auf dem Weg zur Scharnierpartei?
Verwandte Zentren und Programme
Weitere Forschungszentren und ProgrammeMehr erfahren
Unsere VeröffentlichungenDie Deutsch-Französische Brigade und der Wiederaufbau der europäischen Verteidigung
Seit Donald Trumps Rückkehr ist klar: Das europäische Einigungsprojekt ist existenziell gefährdet. Gelingt es den Europäern angesichts des anhaltenden Krieges in der Ukraine und schwindenden US-Sicherheitsgarantien nicht, verteidigungspolitisch souverän zu werden, werden die Integrationsbereitschaft im Inneren und die Attraktivität der EU nach außen weiter erodieren.
Friedrich Merz und die „Zeitenwende 2.0“: eine „neue Ära“ für die transatlantischen Beziehungen?
Am 23. Februar 2025 waren fast 60 Millionen Wähler aufgerufen, einen neuen Bundestag zu wählen. Diese Wahlen werden auch eine neue Regierung in der größten Volkswirtschaft Europas hervorbringen.
Nach den Wahlen: Deutschland auf der Suche nach erschütterter Stabilität?
Mit einer Wahlbeteiligung von 82,5 % hat Deutschland die höchste Beteiligung seit 1987 verzeichnet – ein Anstieg um 6,1 Prozentpunkte im Vergleich zu 2021. Wie schon damals hat die hohe Wahlbeteiligung vor allem der Alternative für Deutschland (AfD) genutzt, die viele frühere Nichtwähler mobilisieren konnte. Viele Wähler wollten mit ihrer Stimme die scheidende Regierung abstrafen, deren Zustimmung vor dem Bruch der Koalition im November 2024 nur noch bei 14 % lag. Deutschland steuert nun aller Wahrscheinlichkeit nach auf eine Große Koalition aus CDU/CSU und SPD zu – die Sondierungsgespräche haben am 28. Februar begonnen.
Wartet Frankreich auf Friedrich Merz?
In den vergangenen Wochen hat sich Friedrich Merz wiederholt für eine engere deutsch-französische Zusammenarbeit ausgesprochen. Wie viel Veränderung könnten seine Appelle tatsächlich bewirken?








