Parteiensystem im Wandel – Piraten künftig an Bord?
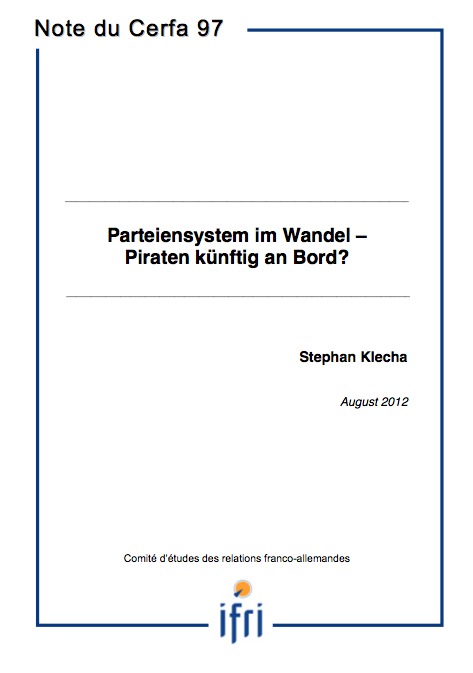
Die deutsche Parteienlandschaft war über lange Zeiten stabil und berechenbar, doch dies scheint sich zu ändern. Die traditionell großen Parteien haben immer mehr Mühe Wähler an sich zu binden und neuen Parteien gelingt es immer häufiger bei Landtags- und Kommunalwahlen Mandate zu erlangen. Dieser Wandel kann Regierungsbildungen in Zukunft erheblich beeinflussen, da es traditionellen Koalitionen wie rot-grün oder schwarz-gelb schwerer fällt Mehrheiten zu bilden. Unter diesen neuen Akteuren hat, seit Herbst 2011, die Piratenpartei die Hauptrolle, da sie als einziger neuer Akteur eine Chance hat, in den Bundestag einzuziehen.
Die Wählerschaft konnte durch Fragen der Netzpolitik mobilisiert werden, vor allen Dingen hat die Partei jedoch eine hohe Anzahl an Protestwählern angezogen, die sie jetzt längerfristig an sich binden muss. Dank einer polyzentrischen und hybridischen Architektur, zeigen sich die Piraten im Rahmen von Wahlkampagnen effizient, aber danach professionell chaotisch. Gewählte Abgeordnete üben ein völlig freies Mandat aus und Entscheidungen werden ausschließlich auf Vollversammlungen getroffen. Problematisch scheint dies jedoch bei der Bildung eines umfassenden Parteiprogramms zu sein und eine Teilnahme an einer Mehrheitsbildung wird verhindert. Bei zunehmender Wählerkraft stellt sich nun die Frage, welche Rolle die Piratenpartei bei zukünftigen Regierungsbildungen spielen kann. Obwohl sie bisher noch nicht als Koalitionspartner in Frage kam und ihre Struktur sie nicht als Regierungspartei empfiehlt, kann sie durch weitere Wahlerfolge das Stimmenverhältnis verändern und die Bildung altbekannter Koalitionen deutlich erschweren.
Stephan Klecha ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Demokratieforschung der Georg-August-Universität Göttingen. Gegenwärtig arbeitet er an einer Studie zur Piratenpartei, die von der Otto-Brenner-Stiftung gefördert wird.

Inhalte verfügbar in :
Regionen und Themen
Verwendung
So zitieren Sie diese VeröffentlichungTeilen
Verwandte Zentren und Programme
Weitere Forschungszentren und ProgrammeMehr erfahren
Unsere VeröffentlichungenDie Deutsch-Französische Brigade und der Wiederaufbau der europäischen Verteidigung
Seit Donald Trumps Rückkehr ist klar: Das europäische Einigungsprojekt ist existenziell gefährdet. Gelingt es den Europäern angesichts des anhaltenden Krieges in der Ukraine und schwindenden US-Sicherheitsgarantien nicht, verteidigungspolitisch souverän zu werden, werden die Integrationsbereitschaft im Inneren und die Attraktivität der EU nach außen weiter erodieren.
Friedrich Merz und die „Zeitenwende 2.0“: eine „neue Ära“ für die transatlantischen Beziehungen?
Am 23. Februar 2025 waren fast 60 Millionen Wähler aufgerufen, einen neuen Bundestag zu wählen. Diese Wahlen werden auch eine neue Regierung in der größten Volkswirtschaft Europas hervorbringen.
Nach den Wahlen: Deutschland auf der Suche nach erschütterter Stabilität?
Mit einer Wahlbeteiligung von 82,5 % hat Deutschland die höchste Beteiligung seit 1987 verzeichnet – ein Anstieg um 6,1 Prozentpunkte im Vergleich zu 2021. Wie schon damals hat die hohe Wahlbeteiligung vor allem der Alternative für Deutschland (AfD) genutzt, die viele frühere Nichtwähler mobilisieren konnte. Viele Wähler wollten mit ihrer Stimme die scheidende Regierung abstrafen, deren Zustimmung vor dem Bruch der Koalition im November 2024 nur noch bei 14 % lag. Deutschland steuert nun aller Wahrscheinlichkeit nach auf eine Große Koalition aus CDU/CSU und SPD zu – die Sondierungsgespräche haben am 28. Februar begonnen.
Wartet Frankreich auf Friedrich Merz?
In den vergangenen Wochen hat sich Friedrich Merz wiederholt für eine engere deutsch-französische Zusammenarbeit ausgesprochen. Wie viel Veränderung könnten seine Appelle tatsächlich bewirken?








